Thomas Bernhard - Der deutsche Mittagstisch
Tintenfisch 17 Jahrbuch: Deuttsche Literatur 1979, Verlag Klaus Wagenbach, 1979
Eine Tragödie für ein Burgtheatergastspiel in Deutschland
Herr und Frau Bernhard, ihre Töchter, ihre Söhne, ihre Enkel, ihre Urenkel und deren engste Verwandte, achtundneunzig Personen um einen kleinen, nicht ganz runden Mittagstisch. Eiche natur.
HERR BERNHARD aufbrausend
Ihr müßt euch Zeit nehmen
FRAU BERNHARD
Die Zeit nehmen
HERR BERNHARD
Zum essen
Denkt an eure Mutter
und an die Mutter der Mutter eurer Mutter
Alle außer Herr und Frau Bernhard schauen sich an
FRAU BERNHARD
Die Revolution wird euch alle vernichten
dann habt ihr eine solche Suppe wie diese nicht mehr
DER JÜNGSTE DER URURENKEL schreit auf
Keine einzige Kartoffel mehr
DER ÄLTESTE DER URURENKEL
Keine einzige Kartoffel mehr
in ganz Deutschland
FRAU BERNHARD heiser
Weil die Krebsfürsorge alles aufgefressen hat
HERR BERNHARD
Und die Nato
AWACS
FRAU BERNHARD
Daß ihr mir nicht laut sagt
was wir gesagt haben
fragt: Ist die Suppe nicht gut
Alle nicken
DER ZWEITÄLTESTE URENKEL (nicht Ururenkel!)
Der neue Bundespräsident ist ein Nazi
DER DRITTÄLTESTE URURENKEL (nicht Urenkel!)
Und der alte Bundespräsident war auch ein Nazi
DER ÄLTESTE ENKEL
Die Deutschen sind alle Nazi
FRAU BERNHARD
Hört auf mit der Politik
eßt die Suppe
HERR BERNHARD springt auf
Jetzt hab ich aber genug
In jeder Suppe findet ihr die Nazis
schlägt mit den Händen in den noch vollen Suppenteller und schreit
Nazisuppe
Nazisuppe
Nazisuppe
FRAU BERNHARD ist aufgesprungen und schreit und zeigt mit dem Zeigefinger auf die Hose des Herrn Bernhard
Da seht
er hat seine Nazihose an
die Nazihose hat er an
DER ÄLTESTE URENKEL schreiend
Die Nazihose
die deutsche Vaternazihose
FRAU BERNHARD sinkt in ihren Stuhl zurück und schlägt die Hände vors Gesicht
Wie ich mich schäme
Mein Gott
Mein Gott grüßgott wie ich mich schäme
Wie Scheel
wie Scheel
wie Scheel
DIE JÜNGSTE URENKELIN laut
Und wie Carstens
und wie Carstens
FRAU BERNHARD
Muß das sein
HERR BERNHARD
Es ist immer das gleiche
kaum sitzen wir bei Tisch
an der Eiche
findet einer einen Nazi in der Suppe
und statt der guten alten Nudelsuppe
bekommen wir jeden Tag die Nazisuppe auf den Tisch
lauter Nazis statt Nudeln
FRAU BERNHARD
Mein lieber Mann
hör mich an
wir bekommen in ganz Deutschland keine Nudeln mehr
nur noch Nazis
ganz gleich wo wir Nudeln einkaufen
es sind immer nur Nazis
ganz gleich was für eine Nudelpackung wir aufmachen
es quellen immer nur noch Nazis heraus
und wenn wir das Ganze aufkochen
quillt es fürchterlich auf
Ich kann nichts dafür
Alle werfen ihre Suppenlöffel hin
DER JÜNGSTE URENKEL
Laßt doch die Mutter in Ruhe
FRAU BERNHARD mit dem Gesicht in der deutschen Mutterschürze, kleinlaut
Schließlich habt ihr ja alle
den Nazionalsozialismus mit dem Löffel gegessen
Alle stürzen sich auf die Frau Bernhard und erwürgen sie. Der älteste Urenkel schreit in die Stille hinein
Mutter
ENDE
B. Traven - Die Baumwollpflücker
ISBN: 9783499105098 | rororo | 1970
Der Roman trägt unverkennbar autobiographische Züge: Gales, ein mittellos durch die Welt trampender Gelegenheitsarbeiter, erzählt in Ich-Form seine Erlebnisse als Baumwollpflücker, Bäcker und Viehtreiber im sozial rückständigen Mexiko der frühen dreißiger Jahre. Überall, wohin er kommt, das gleiche Bild, oft unmenschliche Arbeitsbedingungen und geringer Lohn; einer, der tritt, und einer, der getreten wird. Der packend geschriebene Roman nimmt Partei für die ewig Geprellten und Geschundenen, er appelliert an das Gewissen, um damit den Boden für eine gerechtere Gesellschaftsordnung vorzubereiten.
Gesang der Baumwollpflücker
Vertonung: Anselm Krug
Es trägt der König meine Gabe,
Der Millionär, der Präsident,
Doch ich, der lump'ge Pflücker, habe
in meiner Tasche keinen Cent.
Trab, trab, aufs Feld!
Gleich geht die Sonne auf.
Häng um den Sack,
Zieh fest den Gurt!
Hörst du die Waage kreischen? Nur schwarze Bohnen sind mein Essen,
Statt Fleisch ist roter Pfeffer drin,
Mein Hemde hat der Busch gefressen,
Seitdem ich Baumwollpflücker bin.
Trab, trab, aufs Feld!
Gleich geht die Sonne auf.
Häng um den Sack,
Zieh fest den Gurt!
Hörst du die Waage brüllen? Die Baumwoll' stehet hoch im Preise,
Ich habe keinen ganzen Schuh,
Die Hose hängt mir fetzenweise
Am Ursch, und ist auch vorn nicht zu.
Trab, trab, aufs Feld!
Gleich geht die Sonne auf.
Häng um den Sack,
Zieh fest den Gurt!
Hörst du die Waage wimmern? Und einen Hut hab ich, 'nen alten,
Kein Hälmchen Stroh ist heil daran,
Doch diesen Hut muß ich behalten,
Weil ich ja sonst nicht pflücken kann.
Trab, trab, aufs Feld!
Gleich geht die Sonne auf.
Häng um den Sack,
Zieh fest den Gurt!
Siehst du die Waage zittern? Ich bin verlaust, ein Vagabund,
Und das ist gut, das muß so sein, Käm' keine Baumwoll' rein.
Im Schritt, im Schritt!
Es geht die Sonne auf.
Füll in den Sack
Die Ernte dein!
Die Waage schlag' in Scherb
Maja Lunde - Die Geschichte der Bienen
Der Hörverlag | mp3-CD: 602 Min | ISBN: 9783844524963 | 2017
Von Bienen und Menschen
Aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein
Lesefassung: Katja Semprich
Gelesen von Bibiana Beglau, Markus Fennert und Thomas M. Meinhardt
England. 1832: William, Biologe, Samenhändler und Vater von acht Kindern. verlässt seit Wochen das Bett nicht. Das Geschäft liegt brach. Doch eine Idee könnte alles verändern: ein völlig neuartiger Bienenstock. Ohio,2007: Der Imker George arbeitet hart für seinen Traum. Der Hof soll größer werden, sein Sohn Tom eines Tages übernehmen. Der aber träumt vom Journalismus. Plötzlich geschieht das Unglaubliche: Die Bienen verschwinden. China, 2098: Die Arbeiterin Tao bestäubt von Hand Bäume, denn Bienen gibt es längst nicht mehr. Mehr als alles andere wünscht sie sich ein besseres Leben für ihren Sohn. Doch dann steht alles auf dem Spiel: das Leben ihres Kindes und die Zukunft der Menschheit.
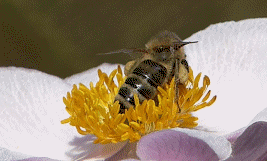
Aufgrund einer Empfehlung für das Buch, habe ich mir das Hörbuch angehört und es hat mir gut gefallen. Eigentlich müßte der Titel aber heißen: Die Geschichte der Imkerei, hatte mehr Infos zu den Bienen an sich erwartet, aber übers Imkern wußte ich vorher auch recht wenig, das hat sich nun - nachdem ich noch einiges nachgelesen habe - geändert. Ansonsten ist die Geschichte schon sehr bedrückend, insbesondere der Zukunftsteil, wenn man zwischendurch dann noch aktuelle Nachrichten hört. Bei den anderen beiden Handlungssträngen tritt, neben den Bienen, mehr das Vater-Sohn-Problem in den Vordergrund (Georg ging mir arg auf den Nerv), bei William gefiel mir besonders seine Tochter Charline...
Hermann Harry Schmitz - Der Fuchs und die Trauben
Buch der Katastrophen - 3 Fabeln ohne Moral, 1916
„Na, ich konnte mir auch denken, daß die Trauben noch nicht reif waren," sagte der Fuchs und stellte den Stuhl, auf welchen er gestiegen war, um die Trauben zu kosten, wieder an seinen Platz.
Er streckte sich behaglich am Fuße des Weinstockes aus und ließ sich die Sonne auf den Pelz brennen.
Von ongefähr kam der Rabe geflogen. Der Rabe war ein Witzbold, ein wenig Satiriker; die Tiere meinten, er sei boshaft. Er selbst hielt sich für einen Lebens-Künstler; er war stets im evening dress.
„Hallo, wie schaut's, alter Freund," - Leute, die man nicht mag, nennt man gern alter Freund - rief er dem Fuchs zu.
„N Tag," erwiderte lässig der Fuchs.
„Ah so, Traubenkur, was?"
„Zu sauer," gähnte der Fuchs faul.
„Verstehe, verstehe," kicherte hämisch der Rabe, flog an den Weinstock und pickte eine dicke Beere ab.
„Pfui Teufel!" Wütend spuckte er aus und flog beschämt davon.
Der Fuchs feixte befriedigt.
Anna Seghers - Das siebte Kreuz / The Seventh Cross
Sieben gekuppte Platanen auf dem »Tanzplatz« des Lagers Westhofen sind durch Querbalken als Folterkreuze für sieben aus dem Lager geflohene Häftlinge hergerichtet. Sechs Männer müssen ihre Flucht bald mit dem Leben bezahlen. Nur dem Mechaniker Georg Heisler gelingt es den Verfolgern zu entkommen. Nach sieben gefährlichen Tagen der Flucht aus dem großen Gefängnis, das Deutschland in den Tagen der Hitlerherrschaft war, findet er den Weg in die Freiheit. Das siebte Kreuz im Lager Westhofen bleibt leer... Dieses Buch, das kurz vor dem zweiten Weltkrieg entstand, zuerst 1942 in englischer Sprache in New York und 1943 in deutscher Sprache in Mexiko erschien, machte Anna Seghers weltberühmt. Es wurde ein Buch das in einer Zeit für Deutschland sprach, als sonst fast nur mit Abscheu von Deutschland gesprochen wurde. Die Passion des ungekreuzigten Heisler ist ein Volksbuch das aus dem durch Hitler erneuerten Mittelalter herausfinden hilft, wie es die Maler und Bildschnitzer vor den Bauernkriegen taten. »Wir fühlten alle«, heißt es am Schluß, »wie tief und furchtbar die äußeren Mächte in den Menschen hineingreifen können, bis in sein Innerstes, aber wir fühlten auch, daß es im Innersten etwas gab, das unangreifbar war und unverletzbar...
Günter Wallraff - Der Aufmacher
Der Mann, der bei Bild Hans Esser war, 1977
Ich hatte in der Redaktionskonferenz vorgeschlagen, mal morgens um sieben ins Arbeitsamt zu gehen und eine Reportage über einen Vormittag auf dem Arbeitsamt zu machen. Ich hatte kaum zu Ende gesprochen, da war das Thema schon abgelehnt, gestorben, weg vom Fenster. »Kein Thema!« Ohne Begründung. Zu jener Zeit ist gerade BILDChefreporter Sigi Trikoleit aus Hamburg als Urlaubsvertretung für Redaktionsleiter Schwindmann in Hannover. Er schickt mich eines morgens in die Stadt, ich soll eine Reportage über Jugendliche machen, die sich in Flipperhallen »herumtreiben«.
Was ich finde, sind arbeitslose Jugendliche, vor allem Ausländer, die sich dutzende Male um einen Job beworben und schließlich aufgegeben haben. Unter anderem treffe ich einen Vierzehnjährigen, der in der gegenüberliegenden Pizzeria arbeitet und für täglich zwölf Stunden im Monat 600 Mark verdient. Ich rufe Trikoleit an und erzähle ihm, was ich erfahren habe. »Lassen Sie mal«, meint er, »kommen Sie zurück, machen Sie bloß kein soziales Thema draus! Ich hab ein bezauberndes Thema für Sie: Wir haben da Material aus Stuttgart. Sie müssen es einhannoveranern. Suchen Sie jetzt mal in der Stadt einen der schönsten Gartenzwerge. Der Gartenzwerg feiert gerade hundertjährigen Geburtstag, ich geb Ihnen Adressen von ein paar Gartenbedarfsgeschäften, lassen Sie ein Foto machen und kommen Sie dann her.«
Ich lasse das Foto machen (und nebenher ein zweites, auf dem ich einen BILD-lesenden Gartenzwerg mime). Es erscheint am nächsten Tag. Auch die Geschichte über die Flipperhallen erscheint. Chefreporter Trikoleit hat sie selbst in die Hand genommen: »Morgens um 9 Uhr, Ich liefere das Spielhallen-Manuskript ab. Trikoleit erfindet die Zitate hinzu und fügt sie eigenständig ins Manuskript ein.
Wenn in den Büros rundum Sekretärinnen fleißig tippen, wenn die Verkäuferinnen in den Kaufhäusern auf die ersten Kunden warten, Juweliere ihre Schaufenster schmücken, wenn also alle Welt in Hannover arbeitet - dann flackern in Las Vegas am Marstall die Irrlichter an den Flipperautomaten. Dann rollt die Plastikkugel, beim Tischfußball, schießt eine Rakete auf einem Bildschirm in den Weltraum...«
Und Trikoleit zeigt, wie's gemacht wird: »Ein 17jähriger Schüler mit langem Lockenhaar: >Scheiße, in der Penne war es so langweilig.< Ein junger arbeitsloser Mann: >Was soll ich zu Hause, da schimpfen sie doch nur rum.< Ein Milchbubi, der von zu Hause fortgelaufen ist: >Hier ist es wenigstens warm!<«
Nichts, gar nichts dergleichen habe ich erlebt. Doch der beruhigt mich. »Tja«, sagte er, »das ist hier nun mal so bei uns, bei diesem schnellen Journalismus muß man sich halt was einfallen lassen.« Was ich geschrieben habe, bleibt nur in Rudimenten erhalten, in den Bruchstücken, die man auch hätte erfinden können. Jede Ähnlichkeit mit wirklichen Personen und ihren Problemen war zufällig. Damit ich aus dieser Erfahrung was lerne, spart Trikoleit aber an diesem Tag nicht mit Lob: »Mit den Gartenzwergen haben Sie sehr geholfen.
Das war Spitze, weiter so!«
Irmgard Keun - Nach Mitternacht
Isbn: 9783123524349 | Bastei Lübbe | 1981
Die Haupthandlung spielt während der nationalsozialistischen Diktatur um das Jahr 1936 an zwei Tagen in Frankfurt am Main, mit den Schwerpunkten des Hitlerauftritts am Opernplatz und Liskas Fest. Für die Erzählerin, die 19-jährige Susanne Moder, genannt Sanna, und ihre politisch engagierten Freunde und Bekannten ist es eine Zeit des Umbruchs und der Entscheidungen für ein an das Regime angepasstes Leben oder die Emigration aus Deutschland.
Die Handlung wird aus der Perspektive und in der Umgangssprache einer 16- bzw. 19-Jährigen vorgeführt. Die Ich-Erzählerin Sanna versteht oft nicht die Redeinhalte der Parteileute und intellektuellen Freunde ihres Bruders und deren ideologischen Hintergrund, aber die Autorin lässt sie das Verhalten der Menschen im Alltag und deren Äußerungen mit dem kindlichen, unverbildeten Blick eines Landmädchens beobachten, deren Äußerungen wiedergeben und kommentieren, teilweise ergänzt durch witzig-ironische Bemerkungen einer lebenserfahrenen Frau. Diese Stilbrüche erzielen beim Leser eine komische Wirkung, vor allem wenn dadurch die Phrasen und grotesken Widersprüche der Hitleranhänger und die eigennützigen Umorientierungsversuche vieler Bürger verfremdet und entlarvt werden.
Als aufmerksame Zuhörerin und Beobachterin charakterisiert und parodiert Sanna die Verhaltensweisen z. B. Liskas, Gertis oder Bettys und gibt, v. a. in den Caféhaus-Szenen, Gespräche über die politische Situation in direkter Rede wieder. So bilden die beiden letzten Kapitel (Kap. 6 und 7) für Heini ein Forum seiner Systemkritik-Monologe und der Journalist erscheint durch seinen Selbstmord als konsequente Gegenfigur zum Dichter Algin. Liska und Betty sind die ihnen entsprechenden Frauen. Der Tragik dieser Beziehungen, ergänzt durch das unglückliche Verhältnis Gertis und Dieter Aarons, wird die Flucht des Paares Sanna und Franz als hoffnungsvoller Aspekt gegenübergestellt.
Die Autorin verdichtet die Handlung immer wieder in symbolischen Kontrastsituationen: Hitler mit der leeren Hand und das instrumentalisierte Bertchen Silias mit dem falschen Strauß oder die misslungene Judenerkennung des Stürmermanns. durch Wünschelrute und Horoskop (Kap. 6) und die folgende skurrile Verbrüderung von Nazi und Jude. Ebenso stehen die ausgelassen singenden und tanzenden Gäste auf der Party der unerfüllten Liebe Liskas zu Heini und dessen Selbstmord gegenüber, der den Untergang ihrer politischen Träume spiegelt. Das alles spielt sich in der Beletage ab, während der wegen eines Angriffs auf einen SA-Mann gesuchte Franz im Keller versteckt auf die Flucht mit Sanna wartet. Die tragischen Entscheidungen vor Mitternacht kontrastieren mit der Hoffnung des neuen Tages nach Mitternacht.
Wikipedia
Am Opernplatz
Gerti und ich saßen im Esplande, um uns wurde es immer leerer, immer leerer, ganz leer. Alle Juden gingen fort. Aus dem Lautsprecher rasten Reden wie ein Gewitter. Voll war das Café von diesen Reden über den Führer, der kommen werde, über das freie Deutschland, übe die Begeisterung der Menge. Zwei ältere Damen kamen herein, dünn und sauber sahen sie aus, unverheiratet und beschränkten Mitteln, wie reisende Lehrerinnen aus einer kleinen Stadt. Sie bestellten Kaffee und Apfeltorte mit Sahne. Als sie anfangen wollten zu essen, wurde im Radio das Horst-Wessel-Lied gespielt, die alten Fräuleins ließen ihre Löffel fallen, standen auf, reckten die Arme. Das muß man, weil man nie weiß, wer einen beobachtet und anzeigt. Vielleicht hatten sie voreinander Angst. Gerti und ich standen auch auf.
Still war das Radio für einen Augenblick. Ein Kellner kam und fragte die Gerti, ob sie von einem Balkon aus alles sehen wolle. Weil wir nun schon mal da waren, wollten wir das natürlich. Wir fuhren mit dem Kellner im Lift auf und ab, alle Balkons waren Nester voller Menschen. Aber der Kellner fand noch einen Balkon, in den er uns reinquetschen konnte. Er selbst hatte kein Interesse daran etwas zu sehen.
Ich saß halb auf dem Schoß von einem dicken Mann, sein Gesicht konnte ich nicht richtig erkennen, sein Atem war war wie ein fetter stinkender Ball, der mir immerzu ins Gesicht flog. Hinter uns saßen elegante Herren und Damen, die benahmen sich still und mit vornehmer Aufmerksamkeit wie in der Loge von einem Theater. Und Gerti sagte auch, es komme ihr vor, als hätten wir Freikarten für einen Theaterplatz, auf den wir eigentlich nicht gehören und für den wir nicht passend angezogen seien.
Rechts auf der Seite vom Opernplatz, wo es so parkartig ist, hatte sich ein schwarzes Meer von Menschen gebildet, die bewegten sich auf und ab in langsamen Wellen. Über ihnen schwamm müdes Licht. Auf dem freigelassenen Platz sprangen und rasten erregt einige SS-Leute herum und schwenkten in wilder Aufregung ihre Arme. Danach geschah immer noch nichts.
Manchmal wurden aus dem Meer von Menschen ohnmächtige Frauen von SS-Männern fortgetragen, dadurch wurde den Leuten in den Logenbalkons das Warten nicht zu langweilig.
Dann glitten auf einmal Autos über die Straße - weich und eilig wie fliegende Daunenfedern. Und so schön! Nie in meinem habe ich so wunderbare Autos gesehen. Und so viele Autos kamen, so viele! Alle Gauleiter und zugehörigen hohen Parteimänner fuhren in solchen Autos, es war herrlich. Die sind sicherlich alle furchtbar reich. Denn wenn ich an den Franz denke und mir ausmale, er würde noch hundert Jahre leben und von morgens bis abends arbeiten - wenn er immer Arbeit hätte - und würde hundert Jahre nicht trinken und kein bißchen rauchen und nichts tun als sparen, sparen, sparen - dann könnte er sich in hundert Jahren immer noch nicht so ein Auto kaufen. In tausend Jahren vielleicht. Aber welcher Mensch wird schon tausend Jahre alt.
Es macht mir Freude, die schönen Autos zu sehen, wie wunderbar blanke rasende Käfer sahen sie von oben aus. Und unten die vielen Leute, die wohl längst schon halb tot vom Warten waren, hatten nun auch Freude, daß ihnen endlich was geboten wurde, allerdings konnten ja nur die Vornstehenden was sehen.
Von weitem schwollen Rufe an: Heil Hitler, näher kam der Mengen Ruf herangewellt, immer näher - nun stieg er zu unserem Balkon empor - breit, heiser und etwas müde. Und langsam fuhr ein Auto vorbei, darin stand der Führer wie der Prinz Karneval im Karnevalszug. Aber er war nicht so lustig und fröhlich wie der Prinz Karneval und warf auch keine Bonbons und Sträußchen, sondern hob nur eine leere Hand.
Ein hellblaues Kügelchen rollte auf die Straße, dem Auto entgegen. Das war Bertchen Silias, die zur heutigen Reihendurchbrecherin ernannt worden war, denn oft wünscht der Führer, mit Kindern fotografiert zu werden. Aber diesmal hatte er wohl keine Lust, Bertchen stand als einsamer kleiner Punkt mit einem riesigen Blumenstrauß.
Vorbei war der Führer. SS-Leute umknieten Bertchen, Blitzlicht flammte, es wurde fotografiert. Nun kommt Bertchen vielleicht doch noch in die Zeitung, wenn auch nur mit SS-Leuten statt mit dem Führer. Dadurch wird die Frau Silias einen kleinen Trost haben.
Auf dem langen Balkon des Opernhauses stellten die jetzigen berühmten Männer sich mit Feierlichkeit auf, mit höflichen Verbeugungen gegeneinander, und sie grüßten auch ins Volk.
Sie taten eigentlich nichts interessantes, aber man durfte sie ansehen.
Gerti meinte, man habe eigentlich nicht viel davon, solche führende Männer anzusehen, die führenden Männer hätten sicher viel mehr davon, wenn sie von uns angesehen würden.
Andererseits waren Damen in unserem Balkon, die freuten sich sehr, daß sie so einen General Blomberg erkennen konnten und Göring, weil er so was Rotes an seine Jacke hatte - man weiß ja von Fotografien her, daß er immer gern aparte Kostüme trägt. Trotzdem er doch eigentlich schon jetzt so bekannt ist, daß er durch besondere Kleidung nicht mehr auffallen braucht.
Zum Algin kommt manchmal ein junger Mann, der ist Schauspieler und findet kein Engagement und muß durch seine Erscheinung wirken und trägt darum leuchtende Schweinslederhandschuhe. Der Göring hat aber doch in seiner Art schon ein Engagement. Andererseits kommen ja auch fertige Filmschauspieler nie zur Ruhe und müssen auch immer wieder von neuem dem Publikum das Äußerste an Mode und Glanz bieten. So ein Göring muß sicher dauern nachdenken, um einem Volk immer Neuigkeiten vorführen zu können. Und dabei müssen diese Männer auch noch immer Zeit zum regieren finden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie das alles schaffen. Der Führer gibt doch schon fast sein ganzes Leben hin, für sein Volk fotografiert zu werden. Man stelle sich nur so eine ungeheure Leistung vor: ununterbrochen sich mit Kindern und Lieblingshunden, im Freien und in Zimmern - immerzu. Und außerdem ständig mit Flugzeugen zu fahren und in langen Wagneropern sitzen, weil das deutsche Kunst ist, für die er sich auch opfert.
Berühmtheit fordert immer Opfer, das habe ich mal in einem Artikel über Marlene Dietrich gelesen. Es heißt ja immer, der Führer würde nur Radieschen essen und Schwarzbrot mit Klatschkäse. Das ist auch so ein Opfer für den Ruhm. Die Filmschauspielerinnen von Hollywood essen manchmal noch viel weniger, weil sie nicht dick werden dürfen. Und sie trinken und rauchen auch nicht, wegen der Schönheit. Die Liska hungert sich manchmal halb tot, nur um abzunehmen.
Ich könnte mir denken, daß unserem Führer daran liegt, eine besonders schlanke Figur zu haben, da er doch immerzu fotografiert und in Wochenschauen und Reichsparteitagfilmen vorgeführt wird. Er möchte vielleicht auch einen Gegensatz bilden zu Göring und dem Minister Ley und vielen Bürgermeistern und Ministern, die wirklich alle auffallend zugenommen haben. Das kann man ja täglich an ihren Bilder in den Illustrierten erkennen.
Da standen diese Herrschaften nun persönlich auf dem Balkon des Opernhauses. Sie blieben erleuchtet, sonst war Nacht. Die Lichter des Platzes wurden gelöscht, damit die Reichswehr zu richtiger Geltung kommen konnte. Denn die hatte blinkende Stahlhelme auf und brennende Fackeln in den Händen, damit tanzte sie zu militärischen Musikklängen eine Art Ballett. Es handelte sich um einen Zapfenstreich und stellte einen historischen Moment dar und sah sehr hübsch aus.
Die Welt war groß und dunkelblau, die tanzenden Männer waren schwarz und gleichmäßig - ohne Gesichter und stumm, in schwarzer Bewegung. Ich habe in einem Kulturfilm mal Kriegstänze von Negern gesehen, die waren etwas lebhafter, aber der Tanz der Reichswehr hat mir auch sehr gut gefallen.
Wiglaf Droste
* 27. Juni 1961 † 15. Mai 2019
Radikaler Dichter, linker Großautor
Die deutsche Sprache war Drostes Kleinod, das er nicht spießig bewahren wollte, sondern beständig und zärtlich und hartnäckig verführte, sich zu immer neuen Höhen aufzuschwingen; in deren historische Tiefen er abtauchte, um „ramentern" und „Rabatten" aus der Versenkung zu holen.
Der Tucholsky unserer Tage
Mitunter noch vor sechs Uhr gibt er sich die Ehre, den ersten Sonnenstrahl eines liebevollen Gedankens ungehemmt durch sich hindurch auf’s Papier fluten zu lassen: Über gutes Essen, über wundervolle Frauen. Oder er räumt umsichtig einen aktuellen Sprachunfall von der Straße, noch bevor wir daran verunglücken können. Oder er liebt einfach: Peter Hacks, Dashiell Hammett, Vincent Klink oder den großen Mitelch Harry Rowohlt.
Von allen Wiglaf Drostes auf dieser Welt war er der Wiglaf Drosteste!
Grönemeyer kann nicht tanzen
Musse feife inne Wind (mit Funny van Dannen)
Die Würde des Menschen ist ein Konjunktiv
Familienbande
Über das Proletariat
